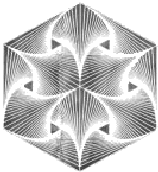
Tools
Obertonbrevier
Soundbeispiele
Tuvas
Noten
Buchtips
CD-Tips
ARS NOVA
Weblinks
www.oberton.info

VIELE STIMMEN AUS EINER KEHLE (von Markus Riccabona)
Die alte Kunst des Obertongesanges als Wegweiser im Paradigmenwechsel
unserer heutigen Zeit
Inhalt:
· Obertongesang in Europa
· Ursprung und Entstehung des Obertongesanges
· Bewußtseinsveränderung durch Gesang
· Die Heilkraft der Obertöne
· Warum Obertongesang wirken kann
· Die Technik des Obertonsingens
· Polyphonie und Temperierung
· Transformation durch Obertöne
"Der ahnungslose Hörer möchte seinen Ohren zunächst
nicht trauen: Da erhebt sich aus dem monotonen Gesang einer Stimme plötzlich
eine zweite und entfaltet über dem unverändert anhaltenden Grundton
eine melodische Linie, deren reine Klanglichkeit und Harmonik allem Irdischen
entrückt zu sein scheint", schreibt der deutsche Obertonsänger
Michael Vetter, der nach einem langen Aufenthalt als Zen-Mönch in
Japan als einer der ersten den Obertongesang in die westliche Welt brachte
- genauer gesagt: zurück brachte:
Erklingt Obertongesang, denkt der Hörer zunächst an exotische
Länder, an tibetische Rituale oder an die weiten Steppen der Mongolei,
wo das Volk der Tuva eine der längsten ununterbrochenen Traditionen
des Obertongesanges vorweisen kann. Die verschiedenen Techniken des Obertongesanges
sind jedoch nicht nur auf wenige ostasiatische Kulturkreise beschränkt.
Der Obertongesang ist vielmehr eine alte heilige Gesangskunst, die einst
in wahrscheinlich allen Kulturen und Religionen verwurzelt war - auch
hier bei uns in Europa.
In einer Zeit des Umbruchs und tiefgreifenden Paradigmenwechsels ist es
vielleicht mehr die unbewußte Erinnerung westlicher Sänger,
die uns eine schon vergessene Welt des Klanges wieder eröffnet, als
eine reine Nachahmung ethnischer Musik. Der leider vor kurzem verstorbene
"Jazzprofessor" Joachim Ernst Berendt schreibt in seinem Buch
"Das Dritte Ohr": "Jahrhundertelang blühte die edle,
alte Kunst des Obertonsingens in Tibet und in Nordindien, beim sibirisch-mongolischen
Stamm der Tuvas, in buddhistischen Klöstern Japans und Chinas und
bei begnadeten Sängern der südamerikanischen Anden. Aber die
jungen Menschen, die nun plötzlich in Europa und den USA Obertöne
singen, betreiben dies nicht als Imitation von Exotischem. Sie singen
artikulierte und wohlkonturierte Melodie-Phrasen, die ihre Herkunft aus
westlichem Musikempfinden in jedem Ton verraten."
Obertongesang in Europa
In Europa blühte der Obertongesang wahrscheinlich bis zum aufkommen
der Polyphonie und verschwand schließlich mit dem Siegeszug der
Mehrstimmigkeit im 16. Jahrhundert. Eines der letzten Zeugnisse für
Obertongesang finden wir bei Tinctoris, einem neapolitanischen Hofkantor
in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Dieser beschreibt in seinem
Werk "De Inventione et Usu Musice", wie "Gerhard der Brabanter,
mein Landsmann am Hof des Herzogs von Burgund, unter dem rechten Porticus
der berühmten Kirche zu Chartres vor meinen gegenwärtigen Augen
und Ohren den Sopranpart zugleich mit dem Tenor - nicht etwa die Töne
abwechselnd - auf das Vollkommenste sang."
Der "cantus planus", der einstimmige Gesang der Gregorianik,
war höchstwahrscheinlich gar nicht so einstimmig, wie heute angenommen
wird. Es gibt einige Indizien dafür, daß ein Großteil
der Gregorianischen Literatur mit Obertontechniken gesungen wurde. Zumindest
spielte die Verstärkung der Obertöne in den Klangfärbung
der Vokale eine wesentliche Rolle. Der amerikanische Sänger und Musikforscher
Jonathan Goldman schreibt: "Die Schönheit des gregorianischen
Gesangs hat mit seinen hörbaren Obertönen jahrhundertelang die
Kathedralen erfüllt. Der gregorianische Gesang war zunächst
einstimmig; alle Mönche sangen die selbe Melodie mit verlängerten
Vokalen. Dies wurde als ‚cantus planus' bezeichnet. Die verlängerten
Vokale erzeugten Obertöne, die wie eine die Mönche begleitende
Geisterstimme klangen. Im 8. Und 9. Jahrhundert wurden die Obertöne
in mehreren Klöstern sehr viel bewußter angestrebt, als das
heute beim Singen gregorianischer Choräle der Fall ist."
Wir haben zwar keine Tonträger aus jener Zeit, die diese Theorie
bestätigen könnten, aber - wie gesagt - einige Indizien: Erstens
werden bei langen Vokalmodulationen, wie sie in der Gregorianik häufig
vorkommen, zwangsläufig Obertonschwingungen verstärkt. Diese
Tatsache machen sich auch heute im Westen verwendete Obertontechniken
zunutze. Weiters ist der ursprüngliche Standort der Chorgestühle
in romanischen und gotischen Kirchen, besonders die Position des Vorsängers,
zu berücksichtigen. Die geometrischen Proportionen der Kirchen waren
sowohl auf den tellurischen Energiefluß des Standortes, als auch
auf die akustische Entfaltung der Gesänge und Gebete ausgerichtet.
Wer an diesen besonderen Punkten alter Kathedralen oder Klosterkirchen
singt, wird sogar ohne Verwendung komplizierter Techniken sich übereinander
auftürmende Obertonkuppeln erzeugen, die den gesamten Kirchenraum
erfassen. Der erstaunte Zuhörer kann nicht einmal die Richtung bestimmen,
woher diese scheinbar übernatürlichen Klänge kommen. Die
Organistin der Schönbrunner Schloßkapelle, Dr. Gertrude Kastner,
hat diesbezüglich vor allem in Frankreich sehr interessante Untersuchungen
geführt. Schließlich seien noch die faszinierenden Oberton-
Interpretationen von gregorianischen Gesängen Iégor Reznikoffs
erwähnt. Besonders seine Aufnahme von "Marie Medelaine: La Vase
de Parfum" aus der Literatur von Vézelay (Frankreich) eröffnet
eine neue Klangdimension für die mögliche Interpretation von
Gregorianik.
Ursprung und Entstehung des Obertongesanges
Um sich den Ursprüngen des Obertongesanges zu nähern, muß
man sich den Völkern zuwenden, die diese Kunst in einer noch ungebrochenen
Tradition pflegen. Nur so können die dünnen Spuren zurückverfolgt
werden. Auffallend ist, daß in allen Kulturen, die den Obertongesang
noch traditionell verwenden, der Schamanismus oder zumindest schamanische
Elemente noch lebendig sind. In den meisten Fällen finden sich auch
noch Elemente des Nomadentums in diesen Gesellschaften. Das beste Beispiel
dafür sind die Tuva, ein kleines Turkvolk im Gebiet des Altai, an
der Grenze der Russischen Föderation zur Mongolei. Der Schamanismus
- und damit der Obertongesang - hat dort dank der unüberschaubaren
Weitläufigkeit des Gebietes sogar das Verbot und die Verfolgung durch
den Kommunismus überlebt. Galsan Tschinag, ein Schamane und Stammesführer
der Tuva, der kürzlich in Österreich zu Besuch war, führt
sein Volk sogar wieder zur traditionellen nomadischen Lebensweise zurück.
Auch in Tibet lebe ein großer Teil des Volkes bis zur chinesischen
Invasion nomadisch, und der tibetische Buddhismus ist - je nach Sekte
mehr oder weniger stark - von den schamanischen Elementen der ursprünglichen
Bön-Religion durchsetzt. So spielen schamanische Rituale, besonders
bei der Befragung von Orakeln, immer noch eine wesentliche Rolle.
Schamanismus und Nomadentum weisen auf ein sehr enges Zusammenleben mit
der Natur und ihren Elementen hin. Der Nomade ist den Kräften der
Natur ausgesetzt und hat über die Methoden des Schamanismus immer
versucht, die Bedrohung durch die Naturgewalten möglichst gering
zu halten und gleichzeitig ihre unbegrenzten Kräfte in sein eigenes
Wesen zu integrieren. Durch die Nachahmung eines Tieres vereinigt sich
der Schamane mit dessen Wesen, ja wird selbst zum Geist dieses Tieres
und kann so dessen Eigenschaften für sich und sein Volk nutzbar machen.
Bei den Tuva lernt heute noch jeder Obertonsänger zuerst, die verschiedensten
Tierlaute nachzuahmen. Auch gibt es nach der Legende einen heiligen Wasserfall,
der den Menschen von den Göttern geschenkt wurde, um sie den Obertongesang
zu lehren. Durch das Hineinlauschen in die Klänge der Myriaden von
Tropfen und ihr Zusammenspiel hinter der Oberfläche der rauschenden
und donnernden Wassermasse, dringt der angehende Schamane tiefer in das
Wesen der Natur - auch seiner eigenen - ein. Die tiefe Verbindung mit
den Melodien und Rhythmen der inneren und äußeren Schöpfung
lehrt ihn, in Harmonie mit allen Wesen zu leben. Diese Harmonie drückt
sich wiederum in seinem Gesang aus und überträgt sich im Ritual
auf den Sterbenden, Kranken, Ratsuchenden oder das ganze Volk in Zeiten
der Not.
Bewußtseinsveränderung durch Gesang
Der Gesang - und im Besonderen der Obertongesang - wurde ursprünglich
nur für drei Zwecke verwendet: den Lobpreis Gottes (oder welchen
Namen der Eine in den verschiedenen Kulturen auch tragen mag), die Heilung
und - das Enchantment. In diesem Begriff steckt das englische Wort für
spirituelle Gesänge, "chant", das wiederum vom französischen
"chanter" (singen) stammt. Die französische Redewendung
"je suis enchanté" mit der Bedeutung "ich bin erfreut"
oder auch "ich bin bezaubert" heißt wörtlich übersetzt
eigentlich: "Ich bin besungen."
Wie eng Singen mit Zauber und Entrückung verbunden ist zeigt sich
auch im lateinischen Wort "cantare" von dem sich "chant"
und "chanter" herleiten: seine erste und ursprüngliche
Bedeutung ist nicht "singen", sondern "beschwören"
und "zaubern".
Der französisch-englische Begriff "Enchantment" (Spanisch:
encantamiento) bedeutet also soviel wie "Verzauberung" aber
auch "Entzücken", ja sogar "Verzückung".
So hat dieses Wort über Jahrhunderte hinweg die Wirkung und ursprüngliche
Verwendung von Gesang transportiert: Bewußtseinserweiterung, Trance,
Ekstase, Vision. Durch den Obertongesang gelangte der Schamane in die
Anderswelt der Naturgeister und konnte sein Bewußtsein erweitern
für den Kontakt mit dem Numinosen.
Durch die Tatsache, daß die Obertonreihe nach oben offen, also ihrer
Natur nach unendlich ist, helfen die Frequenzen der Obertöne, die
Schwelle vom Bewußten zum Unbewußten zu überschreiten
und verschiedene Bereiche des Selbst miteinander zu verbinden, was zu
neuen Ein- wie auch Aussichten führt. In diesem Zusammenhang wird
der Obertongesang noch heute verwendet - auch im Westen, etwa bei meditativen
Klangreisen. Joachim Ernst Berendt: "Jeder Weg in den Raum der Obertöne
ist auch ein Weg in die Unendlichkeit." Oder der italienische Obertonsänger
Roberto Lanieri: "Mit den Obertönen als Vehikel gelangst du
in andere Dimensionen."
Die Heilkraft der Obertöne
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Obertongesanges ist, wie schon oben
angeführt, seine heilende Wirkung. Jonathan Goldman schreibt in seinem
Buch "Heilende Klänge - Die Macht der Obertöne": In
den alten schamanistischen Traditionen der Mongolei, Afrikas, Arabiens,
Mexikos, in der geheimen kabbalistischen Tradition von Judentum und Christentum
sowie in den heiligen spirituellen Traditionen Tibets wurden Vokalklänge
und Obertöne benutzt, um zu heilen und zu verwandeln. Im Verlauf
meiner jahrelangen Erforschung therapeutischer und verwandelnder Klänge
habe ich keine Technik entdeckt, die die Macht heiliger Klänge so
sehr verkörpert wie die Obertöne."
Die Heilwirkung des Obertongesanges beruht auf zwei Prinzipien: dem Prinzip
der Schwingung und dem Prinzip der Entsprechung. Das Prinzip der Schwingung
besagt, das alles Schwingung ist. Vom reinen Geist bis zur dichtesten
Materie ist alles in Schwingung und definiert seinen aktuellen Zustand
durch Frequenz und Amplitude. Das Prinzip der Schwingung beinhaltet weiters,
daß Schwingungen einander beeinflussen. Wird also durch Gesang eine
bestimmte Schwingung erzeugt, so beeinflußt diese alle anderen Schwingungsmuster,
mit denen sie in Berührung kommt. Daß dies für alle Ebenen
des Seins gilt, wurde wissenschaftlich durch die Erkenntnisse der Quantenphysik
bestätigt.
Das Prinzip der Entsprechung besagt: Wie oben so unten, wie unten so oben.
In der Musik kennen wir dieses Prinzip als das Gesetz der Oktave: Alle
acht Töne finden wir einen Ton, der in Qualität und Schwingungsmuster
dem ersten entspricht. Er ist nicht identisch mit diesem, verfügt
aber über analoge Eigenschaften, weshalb er auch den gleichen Namen
trägt. Das Gesetz der Oktave gilt nicht nur in der Musik, sondern
erscheint bei allen Arten von Schwingungen.
Das Prinzip der Entsprechung beinhaltet aber auch das Phänomen der
Resonanz, daß nämlich Schwingungen, deren Frequenz ein ganzzahliges
Vielfaches des Ausgangstones aufweisen, mit diesem in Resonanz automatisch
mitschwingen. In der Musik wird diese nach oben offene Schwingungsreihe
ganzzahliger Vielfacher als Obertonreihe bezeichnet. Je niedriger das
Zahlenverhältnis zum Ausgangston ist, desto harmonischer verhalten
sich die Schwingungen zueinander und desto größer ist die Resonanz.
Die Oktaven weisen jeweils die doppelte Schwingungszahl des Grundtones
auf (Verhältnis 2:1) und sind daher das harmonischste Intervall.
Wird auf einem Klavier ein beliebiges "C" angeschlagen, so schwingen
durch das Gesetz der Entsprechung alle anderen C-Saiten mit - obwohl sie
nicht angeschlagen wurden. Analog können wir uns die Wirkung von
Tönen auf den Menschen vorstellen: Die erzeugte Frequenz wirkt nicht
nur in dem Bereich ihrer Erzeugung und akustischen Wahrnehmung, sondern
in entsprechender Weise auch in tieferen und höheren Oktaven anderer
Schwingungsarten. So ist es zu erklären, daß Töne auf
den Körper, das Energiesystem, auf Emotionen und bis in geistige
Bereiche hinein wirksam sind und Schwingungsveränderungen verursachen.
Diese Tatsache macht sich inzwischen auch im Westen die Musiktherapie
zunutze.
Der Obertongesang geht noch einen Schritt weiter. Der harmonikale Aufbau
der Obertonreihe findet sich nicht nur in der Musik, sondern in allen
Bereichen der Natur. Joachim Ernst Berendt schreibt in "Nada Brahma":
"Der Kosmos bis hinein in die Tiefen der Pulsare und Schwarzen Löcher,
die atomare Welt bis hinab zu den Elektronen und Photonen, die Welt in
der wir leben, Pflanzenblätter, Tier- und Menschenkörper und
die Mineralien - das alles soll nach Gesetzen der musikalischen Harmonielehre
strukturiert sein und in ihr schwingen? Ist es nicht eher anzunehmen,
daß es sich umgekehrt verhält: Daß die Harmonik der Musik
nach den Strukturgesetzen unserer Welt und des Makro- und Mikrokosmos
gebildet wurde?"
Warum Obertongesang wirken kann
Um die Wirkung von Obertongesang zu verstehen, müssen wir zwischen
Ton und Klang, zwischen Grundton und Oberton unterscheiden können.
Der deutsche Physiker und Obertonforscher Hans Cousto beschreibt in seinem
Buch "Die Oktave": "Zupft man die Saite einer Gitarre oder
einer Sitar und bringt diese so zum klingen, so hört man nicht nur
den Grundton, sondern noch eine ganze Reihe weiterer Töne mit ganzzahligen
Vielfachen der Grundfrequenz. Die Summe dieser Töne, Grundton und
Obertöne, bilden zusammen dann das Klangbild dieses ‚Tones'.
Man nennt die aufsteigende Reihe von Grundton und Obertönen auch
Obertonreihe oder ‚Teiltonreihe'. Der Grundton ist der erste Teilton.
Der erste Oberton, der Oktavton, ist somit der zweite Teilton. Der zweite
Oberton, die Quinte in der ersten Oktave, auch Duodezime genannt, ist
der dritte Teilton u.s.w. Die Nummer des Teiltones verrät gleichzeitig
auch das Frequenzverhältnis zum Grundton. So hat der zweite Teilton
(Oktave) genau die doppelte Frequenz, der dritte Teilton (Duodezime) die
dreifache Frequenz des Grundtones u.s.w.
"Die musikalischen Intervalle werden durch die Teiltonverhältnisse
bestimmt. Je einfacher das ganzzahlige Verhältnis ist, desto reiner
empfinden wir dieses Intervall. Andererseits, je weiter die beiden Zahlenwerte
eines Teiltonverhältnisses auseinander liegen, desto unharmonischer
oder auch spannender wird das Verhältnis empfunden. In der Obertonreihe
und ihrer Struktur liegen viele Geheimnisse verborgen. Sämtliche
Grundlagen der Harmonielehre werden aus den Zahlenverhältnissen der
Obertöne abgeleitet.
"In der ersten Oktave liegen keine weiteren Obertöne, in der
zweiten einer, in der dritten drei, in der vierten sieben. Die fünfte
(Teilton 16 bis 32) enthält fünfzehn, die sechste (32 bis 64)
einunddreißig, die siebte (64 bis 128) dreiundsechzig. (...) Bevor
noch die achte Oktave erreicht ist, werden die Intervalle zweier aufeinanderfolgender
Obertöne so klein, daß das menschliche Ohr sie nicht mehr deutlich
unterscheiden kann. Die Obertonreihe wird zu einem ansteigenden Kontinuum
von Klangschwingungen."
Durch den Obertongesang werden Sänger wie auch Zuhörer mit der
Schöpfung innewohnenden harmonikalen Strukturen in Resonanz, in Einklang
gebracht. Der Grundton dient hier als Vehikel, als Transportmittel. Die
Obertöne sind die eigentlichen Wirkstoffe, die Transportiert werden.
Der Grundton ist mit einem Zug vergleichbar, der eine bestimmte Strecke
zu einem bestimmten Ziel fährt. Dies sagt jedoch noch nichts über
seine Ladung aus, die er mit sich führt. Die Auswahl der Obertöne,
die über dem Grundton zum Klingen gebracht werden, bestimmen erst
die Qualität der "Ladung". Das Verhältnis von Grundton
zu Oberton in ihrer Wirkung läßt sich auch durch einen Vergleich
mit einem Medikament veranschaulichen: Das Heilmittel (Oberton) wird von
einer bestimmten Trägersubstanz (Grundton) an den Ort gebracht, wo
es wirken soll.
Jeder Grundton hat einen bestimmten Bereich im physischen Körper
und im Energiesystem des Menschen, wo er besonders stark schwingt, also
Resonanz findet. Die Zuordnung zu Körperteilen, Organen und Energiezentren
(Chakras) geschieht durch die Systeme verschiedener, Jahrtausende alter
Traditionen etwa aus Indien, Tibet oder China, durch die entsprechenden
Planetentöne und besonders durch die empirische Ermittlung aus der
persönlichen Anwendung. Der Grundton kann nun bestimmte, vom Sänger
bewußt ausgewählte Obertöne seines Spektrums transportieren.
Obertöne können je nach ihrer Stellung in der Obertonreihe,
also ihrem Intervall zum Grundton, verschiedene Wirkungen haben: aktivierend,
harmonisierend, beruhigend, wärmend, kühlend, steigend, sinkend,
öffnend, schließend etc.
Durch das Zusammenwirken von Grundton (Ort der Wirkung) und Oberton (Art
der Wirkung) kann der therapeutisch arbeitende Obertonsänger spezifische
Wirkungen vor allem im energetischen Bereich erzielen.
Die Technik des Obertonsingens
Für die Erzeugung von Obertönen gibt es zahlreiche verschiedene
Techniken. Streng genommen werden die Obertöne nicht erzeugt, sondern
aus dem jeweiligen Grundton, in dem sie als Potential mitschwingen, isoliert
und verstärkt. Jede Tradition, jedes Volk hat im Laufe der Geschichte
höchst unterschiedliche Techniken entwickelt. Auch im Westen sind
seit der Wiederentdeckung des Obertongesanges wieder neue, nicht ethnisch-traditionelle
Techniken entstanden.
Michael Vetter verfolgt die Entstehung der Obertöne bis zurück
in den Sprachprozeß: "Wir sprechen, ohne es zu wissen in Akkordfolgen."
Sprechen wir ein "A", "E", "I" oder "U",
so können wir diese Vokale nur durch ihre unterschiedliche Zusammensetzung
aus Obertönen erkennen. Ganz automatisch wählen wir beim Sprechen
bestimmte Obertongruppen, die dem artikulierten Laut die entsprechende
Klangfarbe geben. Dies geschieht durch unterschiedliche Lippen-, Zungen-,
Kiefer- und Rachenstellungen sowie verschiedene Resonanzen. Auch bei jedem
einzelnen Vokal kennen wir unzählige Variationen des Klangbildes.
So können wir beispielsweise durch minimale Änderung der Lippenrundung
ein geschlossenes oder ein offenes "O" artikulieren - wie in
"Mond" und "Sonne".
Wir kennen sogenannte "tiefe", "mittlere" und "hohe"
Vokale. Diese Bezeichnungen sagen bereits einiges über die Oberton-Zusammensetzungen
aus. Das tiefe "U" etwa ist sehr reich an tiefen Obertönen,
das hohe "I" hingegen setzt sich hauptsächlich aus wenigen
Obertönen höherer Oktaven zusammen. So gibt es unendlich viele
Kombinationen von Obertönen, die das Klangbild der Sprache bestimmen.
Beim Obertongesang wird nun ganz bewußt ein einzelner Oberton des
Grundtones isoliert. Durch spezielle Techniken - von denen einige jahrelang
geübt werden müssen - von Lippen- und Zungenstellungen sowie
Resonanzbildungen werden einzelne Obertöne von brillanter Klarheit
aus einem Klang "herausgefiltert". Durch gezielte Veränderungen
der Resonanzbedingungen in Mund und Nase können Melodien quer durch
die Teiltonreihe gesungen werden.
Diese Technik des Obertonsingens hat nichts zu tun mit der Kopfstimme,
dem sogenannten Falsettgesang oder Countertenor. Beim Obertongesang sind
zwei Töne zugleich hörbar: der Grundton, den der Kehlkopf produziert,
und einzelne glasklare Obertöne, die isoliert und verstärkt
werden. Verschiedene Techniken gestatten eine solche Brillanz und Intensität
der Obertöne, daß diese wesentlich lauter als der Grundton
klingen und von Hörer als eigene, abgehobene Melodiestimme erkannt
werden können.
Der deutsche Obertonsänger und -forscher Peter Michael Hamel schreibt
in seinem Buch "Durch Musik zum Selbst": "Er (ein Mongole,
Anm.) summt oder singt nasal einen Ton in mittlerer Lage an und verändert
den Raum in der Mundhöhle durch Öffnen und Schließen des
Mundraums, wodurch er das Obertonspektrum des einzelnen angehaltenen Tones
verändert. In großer Höhe erklingt plötzlich sehr
hoch eine schrille Melodie, die freilich nur aus verstärkten Obertönen
eines einzigen Grundtones besteht."
Polyphonie und Temperierung
Mit dem Konzil zu Trient (1561 - 1563) wurde die Polyphonie offiziell
vom Papst als Grundlage der neuen Kirchenmusik anerkannt. Damit waren
Sänger, die einen oder mehrere isolierte Obertöne gleichzeitig
zum Grundton produzieren konnten, nicht mehr gefragt. Eine ganz neue Faszination
ging von den nun bis zu 18-stimmigen Chören aus, eine Faszination,
die bis heute unser Musikempfinden und vor allem unsere Gewohnheit zu
Hören prägt: die Oberflächlichkeit.
Angesichts der großartigen Werke, die uns das westliche Musiksystem
seitdem geschenkt hat, mag das hart, ja beleidigend klingen. Doch die
Fülle von Stimmen und Melodien hat unsere Wahrnehmung und unsere
Aufmerksamkeit vom Wesen-tlichen der Musik, von ihrem Innenraum weg zur
Oberfläche geführt. Auch die Einführung der temperierten
Stimmung im 18. Jahrhundert ließ das Obertonbewußtsein der
abendländischen Kultur immer mehr verkümmern, wie Joachim Ernst
Berendt in "Das Dritte Ohr" schreibt: "Temperierung läuft
darauf hinaus, daß die natürliche Stimmung die jeder einzelne
Ton durch die mit ihm und in ihm klingende Obertonreihe postuliert, negiert
wird. Es ist fast so, als ob ein Musikstück, das in temperierter
Stimmung gespielt wird - also praktisch jedes Stück westlicher Musik
-, mit jedem einzelnen Ton darauf bestehe: corrigez la nature! Jeder Ton
in einem solchen Stück - von der Oktave abgesehen - erklingt nicht
mehr in seinen natürlichen Relationen, sondern in jenen, mit denen
es der Mensch ‚besser' zu machen glaubte."
Die Renaissance des Obertongesanges gerade in der westlichen Welt ist
ein Hinweis auf die notwendige Überwindung des Haftens am Äußeren
und auf die Erweiterung unserer Wahrnehmung auf das Tieferliegende, das
innere Wesen - nicht nur der Töne. Der Siegeszug der Polyphonie fiel
in eine Zeit des Umbruchs, eines tiefgreifenden Paradigmenwechsels. Das
Mittelalter ging zu Ende, und die Neuzeit brach an als Dämmerung
der Wissenschaften, der Rationalität, der Individualisierung. Bei
allem Guten und Wichtigem, das uns diese Entwicklung gebracht hat, ist
doch etwas verloren gegangen. Etwas, das wir heute wieder suchen, in einer
Zeit neuerlichen Umbruchs: die Mystik, die Innenschau, die Stille. Elemente,
die für den Obertongesang wesentlich sind.
Um Obertöne als Hörer wahrzunehmen, und noch viel mehr um sie
als Sänger dem Grundton zu entlocken, bedarf es einer inneren Bereitschaft,
eines Sich-Öffnens, eines Hineinlauschens in sich selbst. Beim Obertongesang
ist der Sänger in erster Linie ein Hörender, ein Spürender.
Wie der berühmte französische Stimm- und Hörforscher Alfred
Tomatis sagte: "Du kannst nur das singen, was du auch hören
kannst." Und Tomatis machte mit seinen von ihm entwickelten Geräten
auch wieder hörbar, was wir durch unsere Oberflächlichkeit verlernt
haben zu hören: Die unglaubliche Schönheit der Obertonmelodien
in den Stücken begnadeter Meister. Tomatis hat eine Methode entwickelt,
die vordergründige Melodie eines Stückes herauszufiltern, so
daß für den Hörer "nur" noch der Klang, also
die Obertöne übrigbleiben.
Transformation durch Obertöne
Jeder, der beginnt, Techniken des Obertongesanges zu erlernen, macht
die selbe Erfahrung: Die Wahrnehmung beginnt sich zu verändern. Besonders
das Hören erweitert sich nach und nach zu einer deutlichen Wahrnehmung
des "Klanges" als klar definierte Obertonreihen. Mit einem Mal
wird die Fülle der Obertöne hörbar, die über einem
Chor, einem Orchester schwebt, und diese Empfindung wird viel stärker
und intensiver wahrgenommen als die Oberfläche der Melodie, deren
Töne ja letztlich nur die Grundtöne, die Basis für das
explodierende Spektrum der Obertöne sind.
Der stetige, über längere Zeit gleichbleibende Grundton beim
Obertongesang führt in die tiefe, hinter die Oberfläche der
Melodie, die nach außen statt nach innen weist. Die Obertöne
entfalten ihre ganze Schönheit und Macht in der Stille des eigenen
Innenraumes, beim Sänger wie auch beim Zuhörer. Lenkt die Veränderung
des Grundtones, die Melodie, die Aufmerksamkeit nach außen, an die
Oberfläche, so führen der Klang, die Obertöne, zur inneren
Wahrnehmung, zur Meditation.
Roberto Lanieri schreibt: "Der erste Schritt ist, einen Ton lange
Zeit festzuhalten und zu beobachten. Man nimmt einen Ton und beobachtet
ihn wie durch ein Mikroskop. Ein Tropfen Wasser mag auf den ersten Blick
nicht viel von sich hergeben, aber genauer betrachtet trägt er das
Universum in sich. Es ist vor allem eine Frage der Wahrnehmung, nicht
der Aktion, sondern der Kontemplation. Der Ton wird gleichsam von innen
beleuchtet."
So kann der Obertongesang in der heutigen Zeit der Paradigmenwechsel,
der tiefgreifenden Veränderung in allen Lebensbereichen mithelfen,
einen Weg zu weisen: den Weg vom Scheinbaren zum Wesentlichen, von der
Unrast des Getrieben-Seins zur Stille der Kontemplation, von der äußeren
Oberflächlichkeit zur inneren Tiefe des Selbst. Eine der wesentlichsten
Erkenntnisse, die der Obertongesang schenkt ist: Alle Töne sind in
jedem einzelnen Ton enthalten - in der unendlichen Obertonreihe, die jeder
Ton als Potential in sich birgt. Alles ist eins. Markus Riccabona erstmals
erschienen im "Kunstpunkt", Zeitschrift der Universität
für Musik und Darstellende Kunst in Wien, im Juni 2000
© 2020 by Matthias Birkicht • Matthias.Birkicht@Bremerhaven.de