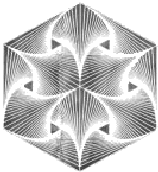
Tools
Obertonbrevier
Soundbeispiele
Tuvas
Noten
Buchtips
CD-Tips
ARS NOVA
Weblinks
www.oberton.info

2.2 Die Obertonsänger von Tuwa (von Michael E. Edgerton und Theodore C. Levin, Spektrum der Wissenschaft vom November 1999, Seite 50)
Sie loten die Grenzbereiche der stimmlichen Fähigkeiten aus: Obertonsänger erzeugen Klänge, die weder der Sprechsprache noch dem Gesang gleichen. Sie singen sogar mehrstimmig und bringen ihren Gesang in Einklang mit Naturgeräuschen. Weite und Stille. Auf dem Gipfel einer jener felsigen Erhebungen stehend, die kreuz und quer die sibirischen Graslandschaften und Taiga-Wälder durchziehen, beeindruckte uns das scheinbar ungestörte Schweigen. Alle vertrauten, von Menschen produzierten Geräusche fehlten. Doch bei immer genauerem Hinhören löste sich das Schweigen in einer Sinfonie von Lauten auf, hervorgebracht von Tieren, Wasser und Wind.
Tuwa ist eine autonome Republik der Russischen Föderation unweit der mongolischen Grenze in Ostsibirien. Die dort mit ihren Herden lebenden Halbnomaden bringen eine Art von Musik hervor, die sich mit diesem allgegenwärtigen akustischen Hintergrund vereint. Umringt von Bergen und weit ab von großen Handelswegen ist Tuwa eine Art musikalische Olduvai-Schlucht - ähnlich jenem Fundort menschlicher Fossilien in Tansania lebt hier ein Archiv aus einer Welt fort, in der sich natürliche und von Menschen gemachte Klänge mischten.
Von den vielen Arten der Hirten, mit ihrer akustischen Umgebung umzugehen, sticht eine wegen ihrer Originalität hervor: eine bemerkenswerte Gesangstechnik, mit der ein einzelner Vokalist zwei getrennte Töne simultan hervorzubringen vermag. Davon dient der eine als Bordun, also als tiefer Begleit- und Halteton wie bei einem Dudelsack. Der zweite - mitunter bis zu vier - tritt als Serie flötenartiger Obertöne auf, die hoch darüber erklingen und musikalisch geformt werden können, um das Zwitschern eines Vogels, die synkopischen Rhythmen eines Bergbaches oder den Schwung eines galoppierenden Pferdes darzustellen.
Die Tuwinen nennen dieses Singen khöömei oder khoomii, abgeleitet vom mongolischen Wort für "Kehle". Im Englischen wird es allgemein als throat-singing (wörtlich "Kehl-Gesang") bezeichnet. Einige zeitgenössische westliche Musiker beherrschen diese Praxis ebenfalls und sprechen vom Obertonsingen, harmonischen Singen oder harmonischen Gesang; im Deutschen ist der erste Begriff verbreiteter. Diese ethnische Musik ist Teil einer ausdrucksvollen Kultur, aber auch ein interessantes physiologisches Phänomen. Es war eine Herausforderung für uns, beide Aspekte zu verstehen, und jeder von uns beiden - einer ein Musikethnograph (Levin), der andere ein Komponist mit Interesse für erweiterte Stimmtechniken - mußte das ungewohnte Gebiet des anderen durchschreiten.
Magische Kraft durch Laute
In Tuwa, so die Legende, lernte die Menschheit vor langer Zeit so zu singen. Sie versuchten, natürliche Klänge nachzuahmen, deren Timbre oder Klangfarben reich an Obertönen sind wie glucksendes Wasser und heulende Winde. Zwar kennen wir die wahre Entstehungsgeschichte der heutzutage praktizierten Techniken nicht, doch die Hirtenmusik der Tuwinen ist sicherlich im Innersten an eine alte Tradition des Animismus gebunden, also an einen Glauben daran, daß natürliche Objekte und Phänomene Seelen haben beziehungsweise von Geistern bewohnt werden.
Diese Beseeltheit von Bergen und Flüssen manifestiert sich in ihrer physischen Gestalt und dem jeweiligen Ort, aber eben auch in den Geräuschen, die sie hervorbringen. Das Echo eines Kliffs zum Beispiel kann von solcher mystischen Bedeutung durchdrungen sein. Auch Tiere, so heißt es, bekunden durch Laute magische Kraft. Menschen können diese durch Imitation aufnehmen.
Unter den Hirten ist die Nachahmung von allerlei Umweltgeräuschen deshalb so selbstverständlich wie das Reden. Das Obertonsingen wird nicht formal gelehrt (wie das in der Musik oft der Fall ist), sondern eher wie eine Sprache aufgenommen. Ein großer Prozentsatz beherrscht die Grundtechnik, nicht jeder vermag auch Melodien hervorzubringen. Ein altes Tabu verbot Frauen bislang die Ausübung, weil khöömei angeblich Unfruchtbarkeit verursache, doch dieser Glaube verblaßt heutzutage und jüngere Frauen beginnen es zu praktizieren.
Die Popularität dieser Gesangsform mag auch einen ganz praktischen Aspekt haben, denn die durch Resonanz verstärkten Obertöne sind weit über die offene Landschaft der Steppe zu hören. Bis vor etwa 20 Jahren fanden übrigens kaum Konzerte statt, weil die Tuwinen diese Musik als zu "hausbacken" ansahen, als daß sie dafür bezahlen wollten. Mittlerweile haben professionelle Ensembles Berühmtheit erlangt, und die Lieblingssänger sind Exponenten der nationalen kulturellen Identität.
Die virtuosesten findet man in Tuwa und in der umgebenden Altai-Region, besonders der westlichen Mongolei. Aber stimmlich verstärkte Obertöne sind auch in verschiedenen Teilen Zentralasiens zu hören. Bei den Baschkiren, einem Turkvolk im Ural, bringen die Musiker behauchte Obertöne hervor, in einem uzliau genannten Stil. Epische Sänger in Usbekistan, Karakalpakien und Kasachstan nutzen die Technik beim Vortrag von Dichtung, und bestimmte Formen tibetanischer Gesänge stellen einen einzelnen ausgehaltenen Oberton über den Grundton. Außerhalb Asiens kennt man diese Technik weniger. Die Xhosa-Frauen in Südafrika beherrschen sie, und - ein ungewöhnlicher Fall musikalischer Improvisation - der texanische Country-Sänger Arthur Miles ersetzte in den zwanziger Jahren das damals übliche Jodeln durch Obertonsingen.
Technik und Akustik dieser Klänge waren noch vor einem Jahrzehnt kaum dokumentiert, bis ethnische Musik ein weltweites Publikum erreichte. Was wir heute wissen, läßt sich am besten mit Hilfe eines weithin benutzten Modells der Stimme erklären, dem Quelle-Filter-Modell. Die Stimmlippen fungieren als Quelle der Schallenergie, die vom Vokaltrakt - dem Filter - in Vokale, Konsonanten und musikalische Noten umgeformt wird.
Einige grundlegende Worte vorweg. Schall breitet sich in einem festen, flüssigen oder gasförmigen Medium als Welle aus; damit verbundene Variablen wie die Position der Moleküle ändern sich an einem Ort von einem Moment zum anderen. Beim Sprechen und Singen entsteht eine solche Welle, weil die Stimmlippen im Kehlkopf durch periodisches Öffnen und Schließen den glatten Luftstrom aus der Lunge (oder in sie hinein) unterbrechen. Da die resultierende Luftdruckschwingung nicht sinusförmig ist, entstehen außer der Grundfrequenz auch ganzzahlige Vielfache davon - die sogenannten Harmonischen oder Obertöne. Der tiefste Ton in der Opernliteratur zum Beispiel ist C mit einer Frequenz von 65,4 Hertz (Schwingungen pro Sekunde); seine Obertöne sind 130,8 Hertz, 196,2 Hertz und so weiter. Mit steigender Frequenz fällt deren Lautstärke jedoch rasch ab.
Die zweite Komponente des Quelle-Filter-Modells, der Vokaltrakt, entspricht vereinfacht einem schalleitenden Rohr. Die Luftsäule darin gerät bei bestimmten Frequenzen, den sogenannten Formanten, in Resonanz, das heißt, diese Frequenzen im Summton der Stimmlippen werden verstärkt, andere abgeschwächt, der Gesamtklang somit geformt.
Verläßt die Schallwelle den Mund, verliert sie mit der Ausbreitung Energie. Diese externe Filterung, bekannt als Strahlungscharakteristik, dämpft tiefe Frequenzen stärker als hohe. Kombiniert produzieren die Quelle, der Filter und die Strahlungscharakteristik einen Klang, dessen Obertöne um 6 Dezibel pro Oktave schwächer werden - außer bei den Formanten.
Beim normalen Singen und Sprechen steckt die meiste Energie in der Grundfrequenz, und die Harmonischen werden eher als Elemente der Klangfarbe wahrgenommen denn als unterschiedliche und eigenständige Töne. Beim Obertongesang jedoch erhält eine einzelne Harmonische eine solche Kraft, daß sie als unabhängiger, flötenartiger, scheinbar körperloser Ton zu hören ist.
Der Mechanismus dieser Verstärkung ist nicht vollständig bekannt. Aber er scheint drei miteinander in Beziehung stehende Komponenten zu umfassen: das Abstimmen eines Obertons auf die Mitte eines schmalen und spitzgipfligen Formanten, die Verlängerung der Schlußphase der Stimmlippenöffnungskurve und die Einengung des Frequenzbereiches, in dem der Formant die Obertöne beeinflußt. Jeder dieser Prozesse entspricht einer dramatischen Verstärkung der Kopplung von Quelle und Filter. Entgegen einer weitverbreiteten Meinung ist keine spezifische, nur Turkvölkern oder Mongolen eigene Physiologie dazu erforderlich; jeder, der sich Mühe gibt, kann das Obertonsingen erlernen.
Ein erfahrener Sänger stellt die Grundfrequenz des Summtons seiner Stimmlippen so ein, daß der gewünschte Oberton mit einem Formant seines Vokaltrakts zusammenfällt. Diese Abstimmung erfolgt sehr präzise, wie der Vergleich von zwei Harmonischen im Experiment zeigte: Die erste war auf das Zentrum einer Formantspitze eingestimmt und gut zu hören, die zweite leicht verstimmt und schwächer. Die Sänger erreichen diese Abstimmung durch Biofeedback: Sie heben oder senken den Grundton, bis der gewünschte Oberton laut erklingt.
Obertonsingen im Experiment
Die Musiker manipulieren aber nicht nur die Rate, mit der sich die Stimmlippen öffnen und schließen (die Grundfrequenz), sondern auch die Art, wie diese das tun. Jeder Zyklus beginnt mit dem Kontakt beider Stimmlippen, also bei geschlossener Stimmritze (Glottis), dem Raum zwischen den Stimmlippen. Sobald die Lunge Luft nach außen preßt, baut sich ein Druck auf, der die Stimmlippen auseinanderdrückt, bis sich die Glottis öffnet. Elastische und aerodynamische Kräfte führen sie wieder zusammen, wobei sie ein Päckchen Luft in den Vokaltrakt schicken.
Elektroglottographen, die über Elektroden am äußeren Hals diesen Zyklus aufzeichnen, zeigen, daß Obertonsänger die Stimmlippen kürzere Zeit offen und längere Zeit geschlossen halten. Der abruptere Verschluß bringt nämlich Obertöne mit höherer Schallenergie hervor. Darüber hinaus hilft die längere Verschlußphase, die Resonanz im Vokaltrakt aufrechtzuerhalten, weil dadurch weniger Energie wieder in die Luftröhre zurückfließen kann. Beide Effekte führen zu einem Spektrum, das mit steigender Frequenz weniger drastisch abfällt und eine Akzentuierung der gewünschten Obertöne unterstützt.
Die dritte Komponente der Verstärkung umfaßt verschiedene Techniken zur Optimierung der Selektivität im Vokaltrakt. So positionieren, erhöhen und schärfen die Sänger die Formanten, indem sie Resonanzeigenschaften verfeinern, die normalerweise dazu dienen, Vokale zu artikulieren (siehe Kasten vorige Seite). Obertöne, deren Frequenz in der schmalen Formantspitze liegt, werden verstärkt, andere abgeschwächt. Zusätzlich schieben die Sänger ihren Unterkiefer vor und stülpen ihre Lippen nach vorn, verengen und runden sie. Dadurch vermindern sie Energieverlust, wirken auf die Schwingungen der Stimmlippen zurück und prägen den Resonanzgipfel noch weiter aus.
In einer Studie mit Tuwinen und westlichen Obertonsängern in der Klinik der Universität von Wisconsin mit Unterstützung des Nationalen Zentrums für Stimme und Sprache wurde durch Videofluoroskopie (Röntgenkinematographie) und flexible Laryngoskopie (Darstellung der Stimmlippen mit einer Videokamera) bestätigt, daß die Sänger ihren Vokaltrakt einstellen, um die Frequenz eines Formanten zu verschieben und mit dem Oberton in Übereinstimmung zu bringen. Durch die Verstärkung verschiedener Harmonischer nacheinander sangen sie eine Melodie.
Die neun Musiker brachten dies auf vier Art und Weisen zustande (weitere Methoden sind möglich). Bei der ersten bleibt die Zunge hinter den oberen Schneidezähnen, während sich ihr mittlerer Bereich zur Intonation hochfrequenterer Harmonischer hebt. Zusätzlich stimmen die Vokalisten den Formant fein ab, indem sie periodisch ihre Lippen leicht öffnen. Im Tuwinischen ist dieser Musikstil als sygyt ("Pfeife") bekannt.
Bei der zweiten Methode bewegen die Sänger die Zunge nach vorn, eine Bewegung, die den Vokal /o/ ("Ton") in den Vokal /i/ ("Kiel") verwandelt. Der erste Formant wird tiefer und der zweite steigt an. Durch präzise Kontrolle des Abstandes zwischen beiden vermag ein tuwinischer Musiker zwei Obertöne gleichzeitig zu verstärken, was zuweilen im khöömei-Stil auftritt. Der dritte Weg bezieht mehr die Bewegungen im Rachen als in der Mundhöhle ein. Für die tieferen Obertöne bewegten die Sänger den Zungengrund an die Rachenhinterwand. Für mittlere bis höhere hingegen führen sie ihn nach vorn und vergrößern so die Grube zwischen Zunge und Kehldeckel (Epiglottis). Für die höchsten Obertöne schwingt dieser nach vorn, um die Grube zu schließen.
Bei der vierten Methode weiten die Vokalisten ihre Mundhöhle in recht präzisen Schritten. Das verkürzt den Vokaltrakt und erhöht die Frequenz des ersten Formanten. Der höchste so zu verstärkende Oberton wird in erster Linie durch Abstrahlungsverluste begrenzt, die mit der Mundöffnung zunehmen. Abhängig von der Grundfrequenz vermag ein Sänger so Obertöne bis zur zwölften Harmonischen zu isolieren. Die Hirten Tuwas kombinieren beim kargyraa-Stil diese Technik mit einer zweiten Schallquelle, um bis zur unglaublich hohen 43. Harmonischen zu singen.
Diese zusätzliche Quelle ist ein weiterer faszinierender Aspekt: Die Sänger nutzen noch andere Organe - einige gehören ebenfalls zum Vokaltrakt -, um einen weiteren ungeformten Klang zu erzeugen, bei einer unmöglich scheinenden tiefen Frequenz. So können die sogenannten Taschenfalten - paarige Gewebe direkt oberhalb der Stimmlippen - ebenfalls den Luftstrom unterbrechen. Auch der untere Teil des Kehldeckels wird verwendet. Eine andere Technik, die fast den gleichen Klang hervorbringt, aber wahrscheinlich in kargyraa nicht vorkommt, kombiniert einen normalen Glottis-Ton mit einer tieffrequenten, pulsartigen Vibration, die auch als vocal fry (Strohbass) bekannt ist.
Weil das kargyraa dem Klang des tibetisch-buddhistischen Gesangs ähnelt, haben einige Forscher den Begriff "Cantus-Weise" benutzt, um es zu beschreiben. Dabei wird generell, wenn auch nicht ausschließlich, angenommen, daß ihm ein Frequenzverhältnis von 2:1 zugrunde liegt. Ein typischer Grundton wäre c bei 130,8 Hertz, mit einer Taschenfaltenvibration eine Oktave tiefer bei 65,4 Hertz (C).
Quintessenz der Klangnachahmung
Eine Spektralanalyse zeigte tatsächlich, daß sich beim Springen in die Cantus-Weise die Zahl der Frequenzkomponenten verdoppelt, das heißt die zweite Schallquelle schwingt periodisch bei der halben Frequenz. Die Cantus-Weise wirkt auch auf die akustischen Eigenschaften des Vokaltraktes. Da ihn der Gebrauch der Taschenfalten um etwa einen Zentimeter verkürzt, verschieben sich die Formanten zu höheren oder tieferen Frequenzen, je nach dem Ort der Einengung.
Das Interesse der Tuwinen gilt freilich eher der expressiven Klangwelt, die all diese Techniken eröffnen, weniger der Virtuosität. Doch wie in jeder Kultur unterliegt auch ihre Musik gewissen Regeln des guten Geschmacks. Beispielsweise vermeiden die Vortragenden auf der siebentönigen Tonleiter zwischen der sechsten und zwölften Harmonischen - dem spektralen Ausschnitt, der von tuwinischen und mongolischen Sängern genutzt wird - den siebenten und den elften Oberton, weil die lokale musikalische Syntax pentatonische (Fünfton-) Melodien vorzieht.
Eine andere kulturelle Eigenart sind Pausen bis zu 30 Sekunden zwischen den Atemzügen. Für einen westlichen Hörer scheinen sie den Fluß aufeinanderfolgender melodischer Phrasen zu unterbrechen, doch in Tuwa gilt jede Phrase als eigenständiges Klangbild. Die langen Pausen geben den Sängern Zeit, sowohl auf die Umgebungsgeräusche zu achten und eine Antwort zu formulieren als auch Luft zu holen. Derartige stilistische Vorlieben reflektieren den ästhetischen Kerngedanken der Klangimitation - den Einklang mit der Natur.
Das Obertonsingen ist nur einesder traditionellen Mittel, mit der natür-lichen akustischen Umgebung zu interagieren. Die Tuwinen spielen auch die ediski, ein Rohr zur Imitation eines weiblichen Moschusrindes; khirlee, ein dünnes Holzstück, das gedreht wird wie ein Propeller, erzeugt den Klang des Windes; amyrga, ein Jagdhorn, ahmt den Paarungsruf eines Hirsches nach; und chadagan, eine Zither, singt im Wind, wenn die Hirten sie auf das Dach ihrer Jurten setzen. Die Spieler der khomus, der Maultrommel, bringen nicht nur Klänge etwa von fließendem oder tropfendem Wasser hervor, sondern auch menschliche Töne einschließlich der Sprache. Gute khomus-Spieler können Texte verschlüsseln, die erfahrene Hörer wieder dekodieren. Schamanen nutzen ebenfalls solche musikalischen Mittel in ihren Heilungsriten.
Das Obertonsingen gilt den Tuwinen jedoch als die Quintessenz all dieser Techniken der Klangnachahmung. Es ist deshalb das in Ehren gehaltene Element einer ausdrucksvollen und sehr alten Sprache, die dort beginnt, wo Worte enden.
Literaturhinweise
Acoustics and Perception of Overtone Singing. Von Gerrit Bloothooft et al. in: Journal of the Acoustical Society of America, Bd. 92, Heft 4, Teil 1, S. 1827 - 1836.
The Hundred Thousand Fools of God: Musical Travels in Central Asia (and Queens, New York). Von Theodore Levin. Indiana University Press, 1997.
Die Physik der Musikinstrumente. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1998.
Choomi - das mongolische Obertonsingen. Grundkurs mit Übungs-CD.
Von Arjopa. Zweitausendeins, Frankfurt 1999.
© 2020 by Matthias Birkicht • Matthias.Birkicht@Bremerhaven.de